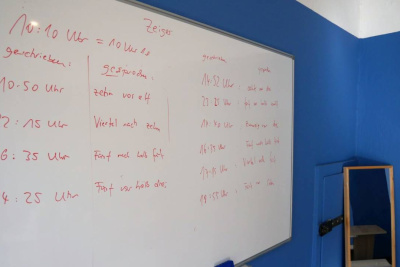"Unsere Idee war, Integration nicht als Almosen zu verstehen, sondern Flüchtlinge so einzusetzen, dass sie ihre Fähigkeiten und Leistungen zeigen und sich auf diese Weise selbst etwas erarbeiten können", erklärt von Alvensleben. "Dadurch begegnen wir uns alle automatisch auf Augenhöhe. Denn unsere Mitarbeiterinnen bekommen nicht nur etwas von uns und der deutschen Gesellschaft, sondern sie geben der Firma und der Gesellschaft auch etwas Gleichwertiges zurück." Für die beiden Gründerinnen liegt darin der Schlüssel zum Erfolg: Ihre Angestellten können stolz auf ihre eigene Leistung sein, sind dadurch engagiert und mit viel Freude dabei. "Das merken wir ganz deutlich am Ergebnis – was in unserer Branche, in der es um hohe Qualität geht, sehr wichtig ist", sagt Claudia Frick. Zusammen mit Werkstattleiterin Eva Weih kümmert sich die gelernte Maßschneiderin um alle inhaltlichen Fragen, gibt den Mitarbeiterinnen Tipps und Anweisungen und behält die Abläufe im Atelier genau im Auge. Rund 30 Labels aus dem gesamten deutschsprachigen Raum lassen bei Stitch by Stitch regelmäßig fertigen, je Bestellung zwischen fünf und 250 Teile – es gibt also viel zu tun für die Frauen.
Gerade junge Designer und Marken benötigen oft nur eine geringe Stückzahl an Mustern und Verkaufsexemplaren, diese dafür aber möglichst zeitnah. Mit dem Niedergang der ehemals bedeutenden deutschen Textilbranche ist es jedoch immer schwieriger geworden, passende Firmen für derartige Aufträge zu finden. "Es gibt bei uns heute vergleichsweise wenige Maßschneider, und die können solche Aufträge höchstens nebenbei als Zubrot annehmen. Insofern besteht da eine Marktlücke, die wir mit unserem Startup optimal füllen", sagt Claudia Frick freudestrahlend. "Die Nachfrage ist seit unserer Gründung riesig, das reißt einfach nicht ab."
Um ihren hohen Standard zu gewährleisten, müssen Nicole von Alvensleben und Claudia Frick bei der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen streng sein. Die Zahl an Bewerberinnen ist deutlich größer, als die zu besetzenden Stellen. "Schneidern ist gerade in Ländern, aus denen viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, weit verbreitet, oft auch auf einem hohen Niveau. Dennoch müssen wir immer wieder Absagen erteilen, weil unsere Aufgaben meist sehr komplex sind", sagt Claudia Frick. Gleichwohl bietet das Handwerk einen großen Integrationsvorteil: Hier kommt es weniger auf Sprache und Zeugnisse an, als vielmehr auf Können und Geschick. "Wir sehen sofort, ob eine Bewerberin das Potential hat. Und das fördern wir dann", sagt Frick. Alle Frauen erhalten eine Nachqualifikation oder eine Ausbildung, um in absehbarer Zeit einen deutschen Gesellenbrief als formellen Abschluss in den Händen zu halten. Währenddessen verdienen sie 9,50 Euro pro Stunde im Atelier.